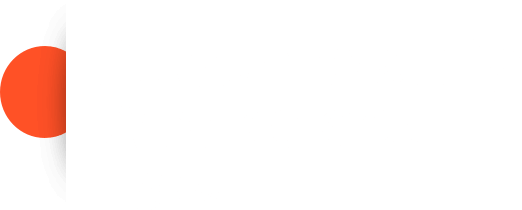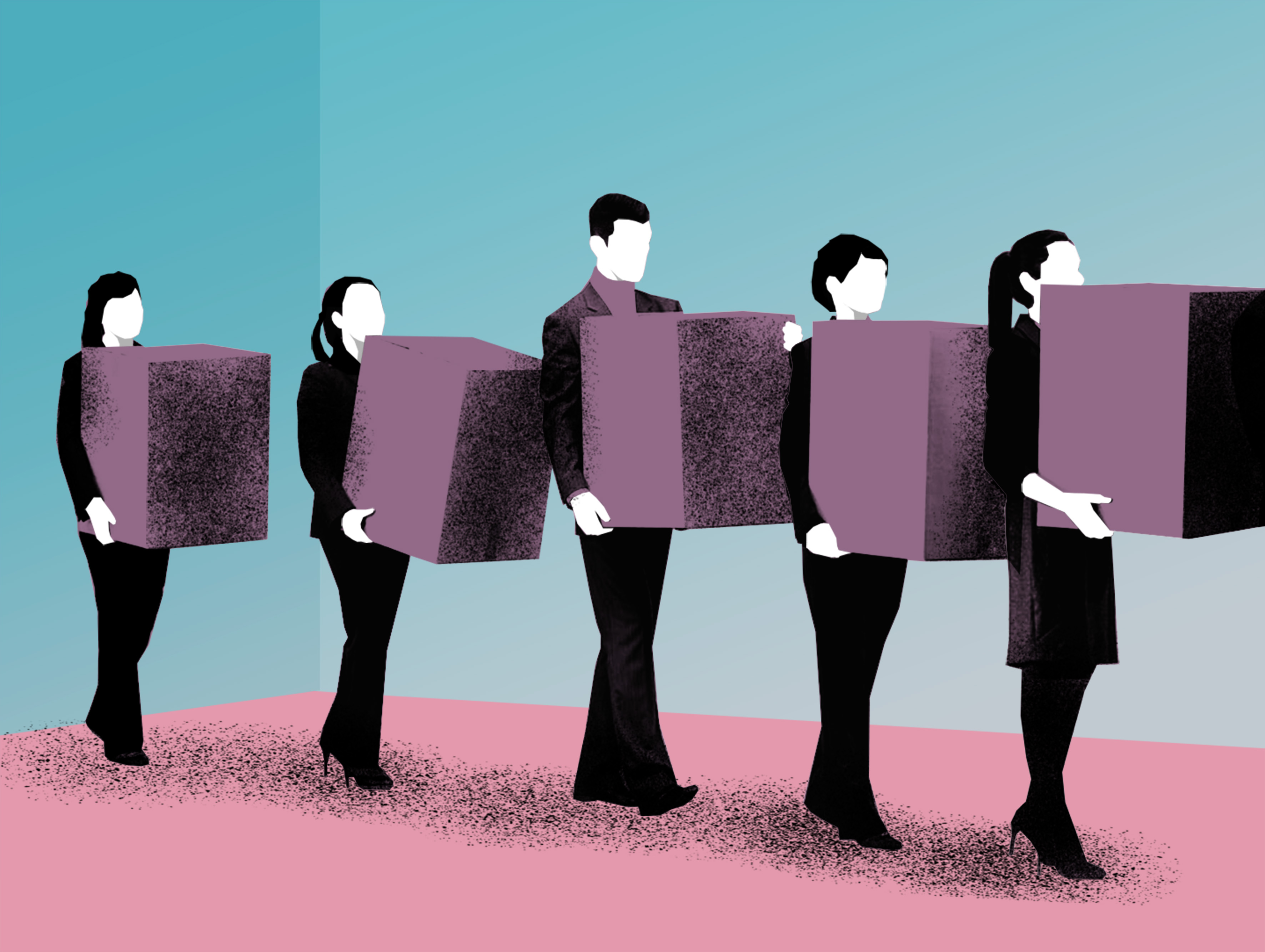Am 30. Oktober 2025 hat der EuGH in der Rechtssache C‑134/24 (Tomann) und der Rechtssache C‑402/24 (Sewel) zwei Vorlagefragen des Bundesarbeitsgerichts beantwortet, von denen sich Viele eine Erleichterung der formellen Vorgaben bei Erstattung einer Massenentlassungsanzeige (MEA) versprochen haben. Vorab: Die Hoffnung war vorerst vergeblich. Was dies nun im Detail bedeutet und welche Fragen weiterhin ungeklärt sind, zeigt der nachfolgende Beitrag.
I. Status Quo – Bedeutung der Massenentlassungsanzeige
1. Europäische Vorgaben
Dass – bei Erreichen der gesetzlich normierten Schwellenwerte – eine MEA abzugeben ist, ergibt sich aus der europäischen Richtlinie 98/59/EG, die von den Mitgliedsstaaten entsprechend umzusetzen war. Diese enthält in Art. 3 dezidierte Vorgaben zum Verfahren der Massenentlassungsanzeige sowie in Art. 4 Vorgaben zur sog. Entlassungssperre, d.h. zur Wirksamkeit von Kündigungen frühestens 30 Tage nach Eingang der MEA.
2. Umsetzung ins deutsche Recht
Diese Regelungen wurden vom deutschen Gesetzgeber in § 17 KSchG im Hinblick auf die Anzeigepflicht und § 18 KSchG im Hinblick auf die Entlassungssperre umgesetzt. Gesetzlich gefordert wird eine Abgabe der MEA bei der Agentur für Arbeit (§ 17 Abs. 1 KSchG), eine Unterrichtung des Betriebsrats (§ 17 Abs. 2 S. 1 KSchG) und eine Zuleitung der Abschrift der Unterrichtung des Betriebsrats an die Agentur für Arbeit (§ 17 Abs. 3 S. 1 KSchG).
3. Ungeregelte Aspekte
Während damit zwar die Pflichten sehr deutlich geregelt sind, ist nicht ausdrücklich normiert, welche Folgen die Nichtabgabe einer (erforderlichen) MEA oder aber die Abgabe einer nicht vollständigen, fehlerhaften MEA haben. Weder das deutsche Recht noch die Richtlinie enthält dazu eine Regelung. Für die Praxis ist das äußerst problematisch, da eine Verletzung dieser formellen und zum Teil recht aufwändig zu erfüllenden Pflichten schnell eintreten kann und sodann das (unverhältnismäßige) Risiko der Unwirksamkeit der ausgesprochenen Kündigungen droht.
II. Entwicklung der Rechtsprechung zu Folgen fehlerhafter Massenentlassungsanzeigen
Das BAG nahm lange Zeit in gefestigter Rechtsprechung an, dass Fehler im Konsultationsverfahren und bei der Anzeige von Massenentlassungen grundsätzlich (bis auf vereinzelte Ausnahmen) zur Unwirksamkeit der ausgesprochenen Kündigungen der Mitarbeitenden führen und stützte dies auf § 134 BGB.
Dies änderte sich scheinbar mit einem Urteil des EuGH vom 28. September 2023, welches einen Individualschutz jedenfalls der Zuleitungspflicht der Abschrift der Mitteilung an den Betriebsrat verneinte (sieh hierzu unseren Blogbeitrag). Verbunden war damit die Hoffnung, dass die Rechtsprechung ggf. auch den Individualschutz anderer Regelungen zur MEA verneint und sich (minimale) Fehler nicht mehr in der Nichtigkeit der Kündigung niederschlagen.
Die Hoffnung wurde umso größer, als der sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts am 14. Dezember 2023 erklärte, seine bisherige Rechtsprechung, nach der jede im Rahmen einer Massenentlassung ausgesprochene Kündigung wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot iSv. § 134 BGB unwirksam ist, aufzugeben (siehe hierzu unseren Blogbeitrag). Offen blieb gleichwohl, welche Folgen eine Verletzung der Vorgaben dann haben sollte.
Anders sah dies aber der zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts, der dem EuGH am 1. Februar 2024 mehrere Fragen zu den Folgen einer nichtabgegeben MEA vorlegte und – vereinfacht gesagt – anfragte, ob eine Kündigung ohne eine solche Anzeige überhaupt wirksam sei (siehe auch hierzu unseren zusammenfassenden Blogbeitrag).
Zuletzt legte sodann auch nochmals der sechste Senat – der offenkundig mit der Vorlage des zweiten Senats nicht einverstanden war – am 23. Mai 2024 dem EuGH weitere Fragen in diesem Kontext bezogen auf die Abgabe fehlerhafter MEAs vor.
III. Entscheidung des EuGH
Nach diesen Kaskaden an Rechtsprechung war die Erwartung an den EuGH, hier nunmehr für Rechtssicherheit zu sorgen, äußerst hoch. Diese Erwartung erfüllte sich nicht. Weder konnte der EuGH alle offenen Fragen abschließend klären noch führt seine Rechtsprechung zu (formellen) Erleichterungen bei Abgabe von MEAs.
Zurück auf Los, bzw. zurück zur Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts im Hinblick auf § 134 BGB möchte man fast meinen. Aber dennoch empfiehlt sich eine etwas genauere Analyse:
1. Vom EuGH entschiedene Fragen
Folgende Fragen wurden vom EuGH beantwortet:
1.1. Zu nichtvorhandenen Massenentlassungsanzeigen
- Es wurde festgestellt, dass eine Kündigung, die einer MEA bedarf, erst nach Ablauf der Entlassungssperre, das heißt 30 Tage nach Abgabe der Massenentlassungsanzeige wirksam wird. Mit anderen Worten: Die ohne MEA ausgesprochene Kündigung bleibt unwirksam, die Abgabe einer MEA ist Wirksamkeitsvoraussetzung der Kündigung.
- Ebenso entschied der EUGH, dass im vorgenannten Fall eine spätere MEA die bereits ausgesprochene Kündigung nicht heilen oder nachträglich legitimieren kann. Die Anzeige muss stets vor der Kündigung erfolgen. Es kann folglich hier allenfalls eine erneute Kündigung nach der Abgabe der MEA ausgesprochen werden.
1.2. Zu fehlerhaften Massenentlassungsanzeigen
Während sich diese Fragen auf eine nicht erteilte MEA bezogen, äußerte sich der EuGH auch zu einer fehlerhaften Anzeige.
- Dabei stellte der EuGH fest, dass es keinen Entscheidungsspielraum der Agentur für Arbeit gibt, um festzustellen, ob eine MEA vollständig ist oder nicht. Selbst wenn die Behörde erklärt, die Anzeige sei vollständig (und eine entsprechende Eingangsbestätigung erteilt) kann also hierauf nicht vertraut werden. Letztlich führt dies dazu, dass bis zu einer gerichtlichen Entscheidung Unsicherheit darüber besteht, ob die MEA wirksam ist.
- Dies soll auch dann gelten, wenn die Agentur für Arbeit ursprüngliche Fehler selbst beseitigt, also bspw. fehlende Informationen selbst einholt. Hier liegen dann zwar formell alle notwendigen Informationen vor – sodass dem Informationszweck genüge getan sein sollte – dem EuGH reicht dies aber nicht.
2. Vom EuGH nicht entschiedene Fragen
Zentrale Fragen blieben ferner durch den EuGH unbeantwortet.
- So äußert er sich nicht ausdrücklich zur entscheidenden Frage, welche Rechtsfolgen sich aus einer fehlerhaften MEA im Hinblick auf die Kündigungen ergeben. Er verweist lediglich darauf, welche Rechtsfolgen nicht ausreichend seien und betont, Sanktionen müssten wirksam, effizient und verhältnismäßig sein. Das hilft gleichwohl nicht weiter, den die eigentliche Frage, ob die Unwirksamkeit der Kündigung gemäß § 134 BGB die einzige denkbare Folge ist, bleibt unbeantwortet.
- Auch die Frage, ob eine fehlerhafte MEA (im Gegensatz zu einer fehlenden MEA) nachträglich geheilt werden kann, bleibt unbeantwortet.
Entsprechende Fragen wurden durch das Bundesarbeitsgericht zwar gestellt, der EuGH wies diese aber als unzulässig ab, da deren Beantwortung für den konkreten Fall nicht von Relevanz war. Anders gesagt, das Bundesarbeitsgericht hatte zwar die richtigen und wichtigen Fragen gestellt, der diesen Fragen zugrundeliegende Fall passte aber dazu nicht.
IV. Ein Ausblick
Zunächst lassen die beiden Urteile des EuGH Ernüchterung aufkommen, da weiterhin zentrale Fragen vollständig unbeantwortet bleiben. In jedem Fall sollte damit auch zukünftig für die Erstellung von MEAs dieselbe Sorgfalt wie bisher angewandt werden, da bei Fehlern weiterhin die Unwirksamkeit der Kündigungen droht.
Bleibt man aber optimistisch, so lässt sich den Urteilen entnehmen, dass im Hinblick auf die Fehlerhaftigkeit von MEAs die Unwirksamkeit von Kündigungen nicht die einzig zwingende Folge ist. Gleichwohl ist völlig unklar – wir hatten hierauf schon in unseren letzten Beiträgen verwiesen – welche alternativen (milderen) Folgen in Betracht kommen. Selbst wenn aber die Rechtsprechung so kreativ sein sollte und mildere Folgen herleitet, so steht auch zu erwarten, dass auch dies dem EuGH wieder vorgelegt würde.
Bereits in unserem letzten Beitrag aus Februar 2024 hatten wir darauf verwiesen, dass „sicherlich noch einige Zeit“ bis zu einer finalen Lösung der Thematik und einer Beantwortung aller offenen Fragen vergehen wird. Dieser Befund ist – leider – weiterhin zutreffend. Gerade das Zusammenspiel zwischen BAG und EuGH, verbunden mit einem im Arbeitsrecht generell häufig behäbigen Gesetzgeber, lassen vermuten, dass eine Vereinfachung allenfalls innerhalb von (einigen) Jahren eintreten wird. Bis dahin heißt es Abwarten, die größtmögliche Sorgfalt bei der Erstellung von MEAs (auch unter Zuhilfenahme von KI) anzuwenden und zu hoffen, dass jedenfalls bei den zahlreichen anderen arbeitsrechtlichen „Baustellen“ der hier ausgebliebene große Sprung gelingt. Möglichkeiten gäbe es jedenfalls genug.