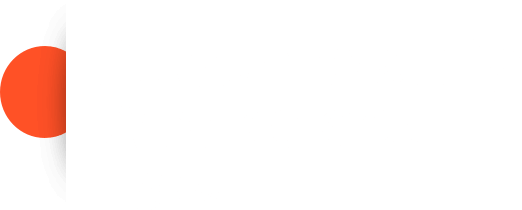Die Umsetzungsfrist sitzt dem deutschen Gesetzgeber im Nacken, denn die Entgelttransparenzrichtlinie („ETRL“) muss bis zum 7. Juni 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden. Bislang wurde das bestehende Entgelttransparenzgesetz nicht an die höheren und weitreichenderen Standards der ETRL angepasst.
Weitergehender ist die Richtlinie insbesondere bei den Schwellenwerten: bislang waren nur größere Arbeitgeber mit mehr als 200 Beschäftigten zur Auskunft gegenüber ihren Mitarbeitern verpflichtet. Dieser Schwellenwert fällt aufgrund des Wortlauts der ETRL vollständig weg – dementsprechend müssen künftig auch KMU (kleine und mittlere Unternehmen) Auskunft erteilen. Auch bei den Berichtspflichten gibt es eine Veränderung des Schwellenwerts: künftig müssen Arbeitgeber mit mehr als 100 Beschäftigten Bericht erstatten – nach dem Entgelttransparenzgesetz liegt die Grenze aktuell noch bei 500 Beschäftigten.
Der Koalitionsvertrag beinhaltet zur Entgelttransparenz Folgendes:
„Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer bis 2030 verwirklichen. Dazu werden wir die EU-Transparenzrichtlinie bürokratiearm in nationales Recht umsetzen. Wir werden eine Kommission einsetzen, die bis Ende 2025 Vorschläge macht.“
(Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode, S. 101)
Diese Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen für die Umsetzung hat nun ihren Bericht vorgelegt. Wir haben die wichtigsten Punkte aus dem Bericht der Kommission für Sie zusammengefasst.
I. Was erwartet Arbeitgeber nach den Vorschlägen der Kommission?
1. Auskunftspflichten
Im Rahmen der Auskunft soll der Arbeitgeber eine nachvollziehbare Erläuterung für die Vergleichsgruppenbildung bereit stellen. Weiterhin ist das Bruttogesamtentgelt anzugeben, d.h. eine Aufschlüsselung einzelner Entgeltbestandteile soll nicht erforderlich sein. Darüber hinaus ist die Kommission der Auffassung, dass nur die durchschnittliche Entgelthöhe anzugeben sei, zur Angabe des Medians, wie nach der aktuellen Gesetzeslage sei der Arbeitgeber nach der ETRL nicht verpflichtet. Der Durchschnitt ersetze den Median.
Die Kommission sieht vor, dass der Auskunftsanspruch auf ein Auskunftsverlangen pro Kalenderjahr begrenzt werden soll. Dies ist tatsächlich ein Schritt in Richtung einer bürokratiearmen Umsetzung, eine Begrenzung ist in jedem Fall wünschenswert, damit sich Arbeitgeber nicht „ständig“ mit Auskunftsverlangen auseinandersetzen müssen.
Die ETRL sieht die Möglichkeit vor, Vergleiche zu hypothetischen oder bereits ausgeschiedenen Mitarbeitenden zu führen. Die Kommission steht dem ablehnend gegenüber. Dies ist erfreulich, so können sich Arbeitgeber darauf konzentrieren, ihr Entgeltsystem jetzt transparent und einheitlich zu halten, ohne dass sie durch etwaige Ausbrecher in der Vergangenheit gebunden sind.
Bei der Auskunft gibt die Kommission zu bedenken, dass das Entgelttransparenzgesetz bislang eine Mindestgröße der Vergleichsgruppe aus Gründen des Datenschutzes vorsah, die Richtlinie enthält hierzu keine Angaben. Die Kommission rät dazu die Grenze des Gesetzes entweder beizubehalten (mindestens fünf Beschäftigte pro Vergleichsgruppe) oder aber jedenfalls festzuhalten, welche Bedeutung dem Datenschutz bei der Auskunft künftig beigemessen wird.
Die Auskunft soll an sich durch den Arbeitgeber erfolgen. Allerdings sei es denkbar, dass der Betriebsrat oder die zuständige Gewerkschaft die Auskunft als „Bote“ an den Beschäftigten weiterleiten könne. Hintergrund ist der Gedanke, dass auf diese Art und Weise Beschäftigte anonym bleiben könnten.
2. Berichtspflichten
Die Kommission stellt für die Berechnung der Entgelthöhe auf das Ist-Entgelt ab. Sie erteilt damit Pauschalierungen mithilfe des Ziel-Entgelts eine Absage, dies steht im Widerspruch zu dem Ziel einer bürokratiearmen Umsetzung, verlangt dies doch eine konkrete Berechnung. Immerhin sieht der Vorschlag eine Öffnungsklausel vor, mit dieser sollen Arbeitgeber selbst entscheiden dürfen, ob sie über variable und ergänzende Entgeltleistungen als Summe (ggf. unterteilt in inhaltlich sinnvolle Gruppen) oder einzeln berichten. Darüber hinaus sollen geringwertige Sachleistungen ausgenommen werden, ebenso wie freiwillige Wahlleistungen und Leistungen wie Aktienoptionen oder Ähnliches, welche nicht vom Vertragsarbeitgeber gewährt werden.
Positiv hervorzuheben sind folgende Kernpunkte der Kommissionsempfehlungen:
- Die Berechnung des Bruttostundenentgelts soll auf Basis der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit erfolgen.
- Variable und ergänzende Entgeltbestandteile werden klar abgegrenzt: Sie zählen nicht zum üblichen monatlichen Grundgehalt.
- Berichtspflichten sollen nur für Arbeitgeber mit mindestens 100 Beschäftigten gelten.
- Eine Beweislastregel wird empfohlen: Ein Entgeltgefälle unter 5 % gilt als widerlegbarer Anschein gegen geschlechterspezifische Diskriminierung.
Offen geblieben ist hingegen leider, wie die Berichtspflichten für Konzernunternehmen aussehen sollen, zwar soll die Konzernmutter grundsätzlich Berichte bündeln dürfen, doch ist offen geblieben, ob die einzelnen Indikatoren über Unternehmen hinweg zusammengefasst werden können. Wie sollen also die Berichtspflichten konkret bei Konzernen ausgestaltet sein, wenn es mehrere Tochtergesellschaften gibt, ggf. auch in unterschiedlichen Mitgliedstaaten der EU, und die Konzernmutter die Berichte bündeln möchte?
3. Abhilfeverfahren
Nach der Richtlinie haben u.a. Arbeitnehmervertretungen ein Recht darauf, von Arbeitgebern zusätzliche Klarstellungen, ins. Erläuterungen zu Entgeltunterschieden aufgrund des Geschlechts, zu den in dem Bericht bereitgestellten Daten anzufordern. Bei Entgeltunterschieden, die nicht auf objektiven, geschlechtsneutralen Merkmalen beruhen, sollen Arbeitgeber mit Arbeitnehmervertretungen Abhilfe schaffen.
Hier schlägt die Kommission ein zweistufiges Verfahren vor. Zunächst soll der Arbeitgeber innerhalb einer Frist von sechs Wochen die Arbeitnehmervertretung unterrichten. Sind Abhilfemaßnahmen nicht unmittelbar verfügbar, sollen beide Seiten einen Fahrplan vereinbaren, der konkrete Fristen beinhaltet.
Was wäre wünschenswert gewesen? Das System, das vorgeschlagen wird, funktioniert so nur für Unternehmen mit Arbeitnehmervertretungen. Zwar nimmt die Kommission dahingehend Stellung, dass es keine Pflicht zur Einrichtung neuer Organe von Arbeitnehmervertretungen wie Betriebsräten geben solle, doch wie die Abhilfe praktisch in solchen Unternehmen durchzusetzen ist, bleibt vollkommen offen. Darüber hinaus fehlt es auch leider an Vorschlägen dazu, ob als Arbeitnehmervertretungen ausschließlich Betriebsräte angesehen werden sollen, oder ob bei tarifgebundenen Arbeitgebern nicht auch die Gewerkschaften taugliche Arbeitnehmervertretungen für den Prozess sind. In der Kommission herrschte dahingehend Uneinigkeit, sodass sie dem Gesetzgeber lediglich riet, die zuständigen Verantwortlichen klar zu benennen, um den Unternehmen Rechtssicherheit zu geben.
4. Privilegierung von Arbeitgebern, die Tarifverträge anwenden
Besonders interessant für viele tarifgebundene oder tarifanwendende Arbeitgeber war die Frage, inwiefern an der nach dem Entgelttransparenzgesetz geltenden Privilegierung von Tarifverträgen festgehalten werden soll und kann.
Die Kommission hat sich dafür entschieden, dazu zu raten, dass die Privilegierung von Tarifverträgen auch bei Umsetzung der ETRL beibehalten werden soll. Das erleichtert tarifgebundenen und tarifanwendenden Arbeitgebern das Leben, denn sie dürften bei der Bestimmung der Vergleichsgruppe die jeweilige tarifliche Entgeltstufe zugrunde legen. Die Vergleichsgruppe ist nur anzupassen, wenn die auskunftsersuchende Person nachweist, dass die Einteilung nach dem Tarifvertrag nicht den Kriterien des Artikel 4 Abs. 4 ETRL entspricht.
Aber auch abseits der Bestimmung der Vergleichsgruppe soll es weitere Erleichterungen bei Tarifverträgen geben:
- längere Fristen zur Beantwortung von Fragen zum Entgelttransparenzbericht und
- längere Fristen im Rahmen von Abhilfeverfahren, soweit tarifliche Entgelte betroffen sind.
Es ist unklar, ob die Vorschläge tatsächlich rechtswirksam umsetzbar sind. Denn die ETRL sieht keine solchen Erleichterungen aufgrund einer Tarifbindung vor. Es ist daher durchaus denkbar, dass – auch wenn der Gesetzgeber diesen Empfehlungen folgt und Erleichterungen aufrechterhält bzw. einführt – diese Regelungen einer gerichtlichen Überprüfung am Ende nicht standhalten würden.
5. Gesetzliche Rechtfertigungsgründe
Die Kommission hat den Vorschlag erarbeitet, dass bei der Umsetzung Rechtfertigungsgründe gesetzlich geregelt werden sollen. Diese sollen nicht abschließend sein und könnten im Sinne von Regelbeispielen Entgeltunterschiede rechtfertigen. Als Vorbild hierfür hatte die Kommission den Rechtfertigungskatalog aus § 10 Satz 3 AGG vor Augen.
Als Beispiel nennt die Kommission Vereinbarungen, die zur Sicherung des Besitzstandes vor Ablauf des 7. Juni 2026 getroffen wurden, wie beispielsweise anlässlich von Umstrukturierungen oder Unternehmenskäufen.
6. Was wäre wünschenswert gewesen?
Die Kommission hat sich mit vielen Fragen auseinandergesetzt, die für Arbeitgeber von praktischer Relevanz sind. Insbesondere die Behandlung, wie tarifgebundene oder tarifanwendende Arbeitgeber bei der Umsetzung berücksichtigt werden sollten, dient sicherlich einer bürokratiearmen Umsetzung – ob dies rechtlich haltbar ist, bleibt abzuwarten. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn sich die Kommission detaillierter mit der Vereinbarkeit einer solchen Begünstigung mit dem Unionsrecht auseinandergesetzt hätte. Darüber hinaus sind einige praktisch relevante Punkte leider offen geblieben, insb. hinsichtlich der Ausgestaltung eines Verfahrens für Abhilfemaßnamen bei fehlenden Arbeitnehmervertretungen oder hinsichtlich der Berichtspflichten in Konzernunternehmen. Es ist angesichts der Herausforderungen fraglich, ob der Gesetzgeber es schaffen wird, den ambitionierten Zeitplan bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist einzuhalten und die Richtlinie rechtzeitig in deutsches Recht umzusetzen.
II. Was erwartet Arbeitgeber nach Ablauf des 7. Juni 2026, falls die Umsetzung nicht rechtzeitig erfolgt?
Bei der Nichtumsetzung einer Richtlinie in nationales Recht sind nationale Gerichte nach Ablauf der Umsetzungsfrist, also ab dem 7. Juni 2026, dazu verpflichtet, nationales Recht richtlinienkonform auszulegen. Da die Richtlinie sehr klare Regelungen enthält, sollte dies für deutsche Gerichte unproblematisch möglich sein. Auch der eindeutige Wortlaut einzelner nationaler Regelungen steht dem Grundsatz der richtlinienkonformen Auslegung nicht entgegen, denn insbesondere bei Diskriminierungsverboten im Arbeitsrecht fordert der EuGH, die nationale Vorschrift unangewendet zu lassen.
Das bedeutet, dass Arbeitgeber ohne gesetzliche Richtschnur vor erheblichen Herausforderungen durch den nahenden Ablauf der Umsetzungsfrist der ETRL stehen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sollten Unternehmen schon jetzt Vorbereitungen treffen, um den Anforderungen gerecht zu werden und ihre Entgeltsysteme möglichst compliant mit der ETRL ausgestalten.
III. Fazit
Es bleibt abzuwarten, inwiefern der Gesetzgeber den Vorschlägen folgen wird, sicherlich dienen diese aber als Richtschnur dessen, was die arbeitsrechtliche Praxis erwarten darf. Auch wenn es angesichts des nahenden Ablaufs der Umsetzungsfrist unwahrscheinlich erscheint, dass der Gesetzgeber die ETRL rechtzeitig umsetzen wird, sollten sich Arbeitgeber nicht zurücklehnen und abwarten, denn auch wenn die Umsetzung nicht rechtzeitig erfolgen sollte, müssen Gerichte soweit möglich, zumindest die bestehenden Regelungen des Entgelttransparenzgesetzes richtlinienkonform auslegen. Dementsprechend gibt es ein Einfallstor für die Anwendung der Vorgaben der Richtlinie mit Ablauf der Umsetzungsfrist.