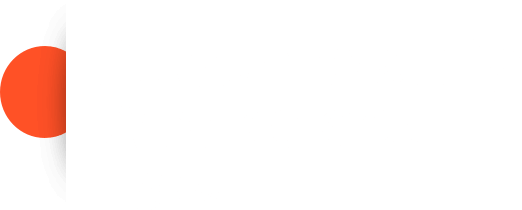Entgeltungleichheit oder Gender Pay Gap – Eine kurze Einordnung
„Gender Pay Gap“. Über kaum einen Begriff wurde und wird mehr diskutiert als über den sogenannten Gender Pay Gap, der den Verdienstabstand pro Stunde zwischen Frauen und Männern beschreibt. Am 30. Januar 2023 veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Zahlen des Jahres 2022: Der unbereinigte Gender Pay Gap lag bei 18 Prozent, während der bereinigte bei 7 Prozent lag. Im letzten Jahr verdienten Frauen mit durchschnittlich 20,05 Euro einen um 4,31 Euro geringeren Bruttostundenverdienst als Männer, der bei 24,36 Euro lag (abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_036_621.html ). Für Frauen hat dies viele Nachteile: Ein geringeres Gehalt wirkt sich nicht nur auf die aktuelle Lebensrealität von Frauen, sondern auch auf deren zukünftige Rentenansprüche aus. Das strukturelle Ungleichgewicht zieht sich daher in der Regel bis zum Lebensende durch.
Was hat nun das Bundesarbeitsgericht damit zu tun?
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit einem Urteil vom 16. Februar 2023 (Az.: 8 AZR 450/21) entschieden, dass eine Frau Anspruch auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit hat, wenn der Arbeitgeber männlichen Kollegen aufgrund des Geschlechts ein höheres Entgelt zahlt. Dies ist erstmal nichts Neues, denn dieser Grundsatz findet mehrere Anknüpfungen im Gesetz. Eine davon ist das Entgeltgleichheitsgebot in § 7 des Entgelttransparenzgesetzes (EntgTranspG), welcher lautet:
„Bei Beschäftigungsverhältnissen darf für gleiche oder für gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts der oder des Beschäftigten ein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt werden als bei einer oder einem Beschäftigten des anderen Geschlechts.“
Das BAG hat nun aber klargestellt, dass sich daran nichts ändert, wenn der männliche Kollege ein höheres Entgelt fordert und der Arbeitgeber dieser Forderung nachgibt. Auch hierzu gibt es einige Studien und Statistiken, die zwar keine gesicherten Ergebnisse liefern können, allerdings Hinweise darauf geben, dass Frauen weniger häufig über ihr Gehalt oder eine mögliche Beförderung verhandeln (z.B. eine Studie von Weltsparen, abrufbar unter: https://www.weltsparen.de/geldanlage/frauen-finanzen/#studie-zu-gehaltsverhandlungen-fast-ein-drittel-der-frauen-geht-leer-aus ).
Worum ging es genau?
Die betroffene Arbeitnehmerin (nennen wir sie Frau U) war als Außendienstlerin im Vertrieb bei einem Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie tätig. Neben ihr arbeiteten im entscheidenden Zeitraum noch zwei männliche Kollegen im selben Bereich. Zu Beginn ihrer Tätigkeit vereinbarten Frau U und ihr Arbeitgeber einzelvertraglich ein Grundgehalt von 3.500,00 EUR brutto. Einer ihrer männlichen Kollegen hatte nur drei Monate vor Frau U seine Tätigkeit angetreten und sich mit dem Angebot in Höhe von 3.500,00 EUR brutto nicht zufrieden gegeben. Er forderte ein Grundgehalt in Höhe von 4.500,00 EUR, welches der Arbeitgeber ihm auch gewährte. Aufgrund der Regelungen eines Haustarifvertrages erhielten sowohl Frau U als auch ihr männlicher Kollege kurzzeitig beide wieder ein Grundgehalt von 3.500,00 EUR brutto, wobei das Gehalt des männlichen Kollegen kurze Zeit später wieder auf 4.000,00 EUR brutto angehoben wurde. Zur Begründung berief sich der Arbeitgeber darauf, dass der Arbeitnehmer einer ausgeschiedenen, besser vergüteten Vertriebsmitarbeiterin nachgefolgt sei.
Frau U klagte nun auf Zahlung der Gehaltsdifferenz und vertrat außerdem die Ansicht, ihr Arbeitgeber schulde ihr eine angemessene Entschädigung, da er sie beim Entgelt aufgrund des Geschlechts benachteiligt habe. Sie scheiterte hierbei vor dem Arbeitsgericht Dresden und dem Landesarbeitsgericht Sachsen.
Die Entscheidung des BAG
Das BAG sah dies anders und hat unter anderem festgestellt, dass der Arbeitgeber Frau U dadurch aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt hat, dass er ihr, obgleich sie und der männliche Kollege gleiche Arbeit verrichteten, ein niedrigeres Grundentgelt gezahlt hat als dem männlichen Kollegen. Die Klägerin hat deshalb einen Anspruch auf einen Lohnausgleich aus Art. 157 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union), § 3 Abs. 1 und § 7 EntgTranspG.
Das BAG hat Frau U außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zugesprochen. Für Frau U stritt in diesem Fall unter anderem die Regelung des § 22 AGG. Diese Norm regelt die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Streit um Equal-Pay Ansprüche und sieht eine Erleichterung der Darlegungslast, eine Absenkung des Beweismaßes und eine Umkehr der Beweislast vor. Kann der benachteiligte Beschäftigte Indizien beweisen, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten lassen (wie z.B. das Geschlecht), trägt der Arbeitgeber die volle Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.
Eine Benachteiligung ergibt sich bereits daraus, dass ein Arbeitgeber Arbeitnehmer mit unterschiedlichem Geschlecht trotz vergleichbarer Tätigkeit unterschiedlich bezahlt (vgl. BAG, Urt. v. 21. Januar 2021 – 8 AZR 488/19). Dies muss der Arbeitnehmer beweisen. Da Frau U dies gelang, musste nun der Arbeitgeber im nächsten Schritt beweisen, dass andere sachliche Gründe abseits des Geschlechts von Frau U die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder diese unterschiedliche Behandlung aus anderen Gründen zulässig ist. Einen solchen Beweis konnte der Arbeitgeber nicht führen, vielmehr berief er sich darauf, dass höhere Grundentgelt des männlichen Kollegen beruhe nicht auf dem Geschlecht, sondern auf dem Umstand, dass dieser ein höheres Entgelt ausgehandelt habe. In Bezug auf die zeitlich spätere Gehaltserhöhung machte der Arbeitgeber geltend, der Arbeitnehmer sei einer besser vergüteten ausgeschiedenen Arbeitnehmerin nachgefolgt. Beide Argumente ließ das BAG nicht gelten.
Welche Auswirkungen sind zu erwarten?
Die Pressemitteilung der besprochenen Entscheidung hat binnen weniger Tage viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Sie wurde als „Paukenschlag“ und „Meilenstein“ bezeichnet. Die Frage ist, ob dem Entgelttransparenzgesetz, welches gerne als „zahnloser Tiger“ beschrieben wird, nun doch Zähne verliehen werden? Dies könnte zukünftig mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dazu motivieren, ihre Auskunftsansprüche nach §§ 10 ff. EntgTranspG geltend zu machen und entsprechende Ausgleichsansprüche gegenüber ihren Arbeitgebern einzufordern. Sicherlich hat das Urteil des BAG den Anspruch von Frauen auf gleichen Lohn deutlich gestärkt. Gleichzeitig kritisieren viele Stimmen, durch das Urteil werde die Privatautonomie, insbesondere bei der Begründung von Arbeitsverhältnissen, eingeschränkt bei denen eine Verhandlung des Gehalts typisch ist. So argumentierte etwa das LAG Sachsen noch dahingehend, dass auf Seiten des Arbeitgebers das Interesse berücksichtigt werden müsse, neue Mitarbeiter zu finden und zu überzeugen – wobei ein höheres Einstiegsgehalt sicherlich helfen kann.
Die Entscheidungsgründe bleiben selbstverständlich abzuwarten, um z.B. hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast sowie der genauen Argumentation des BAG weitere Erkenntnisse zu erlangen. Wo wird z.B. eine Grenzziehung erfolgen, wenn in einer größeren Gruppe von Personen mit derselben Position nur eine Person besser verhandelt hat?
Auch abseits von rechtlichen Fragen werden auch rechtspolitisch die Rufe nach Lohntransparenz immer lauter, gerade um das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu verringern, aber auch um die Marktüblichkeit von angebotenen Gehältern einschätzen zu können. Dies zeigt sich an dem großen Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen an Plattformen wie kununu und Co. Um diesem Bedürfnis nachzukommen, hat die EU-Kommission im Jahr 2021 den Vorschlag einer Richtlinie zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen vorgelegt. Ziel der Richtlinie ist es, Lohndiskriminierung zu bekämpfen und das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu verringern. Die formelle Annahme wird noch dieses Quartal erwartet. Nach seiner Annahme haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.