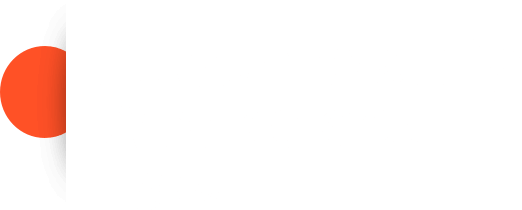Mit Urteil vom 3. Juni 2025 (Az. 9 AZR 104/24) hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) erneut eine wichtige Weichenstellung im Urlaubsrecht vorgenommen: Der gesetzliche Mindesturlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) kann grundsätzlich nicht im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs wirksam „wegverglichen“ werden. Die Entscheidung stellt klar: Die Unverzichtbarkeit des gesetzlichen Mindesturlaubs genießt einen hohen Stellenwert – auch bei einvernehmlicher Streitbeilegung. Das BAG stärkt damit erneut die Arbeitnehmerrechte und erhöht gleichzeitig das Risiko einer nachträglichen Inanspruchnahme des Arbeitgebers.
Der zugrundeliegende Sachverhalt
Der Arbeitnehmer war vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2023 bei der Arbeitgeberin beschäftigt. Vom Jahresbeginn des Jahres 2023 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses war der Kläger durchgehend arbeitsunfähig erkrankt und damit tatsächlich nicht in der Lage, seinen ihm für das Jahr 2023 anteilig zustehenden gesetzlichen Mindesturlaub in Anspruch zu nehmen.
Im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens schlossen die Parteien im März 2023 einen gerichtlichen Vergleich. Darin einigten sie sich darauf, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund einer von dem Arbeitgeber ausgesprochenen Kündigung zum 30. April 2023 gegen Zahlung einer Abfindung in Höhe von 10.000 EUR endet.
Ziffer 7 des Vergleichs enthielt – wie in der Praxis häufig – die Formulierung: „Urlaubsansprüche sind in natura gewährt.“ Darüber hinaus wurde – ebenfalls praxisüblich – eine allgemeine Erledigungsklausel aufgenommen, wonach sämtliche gegenseitigen Ansprüche mit Abschluss des Vergleichs abgegolten sind.
Trotz dieser Regelungen forderte der Arbeitnehmer nachträglich die Abgeltung des gesetzlichen Mindesturlaubs aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.615,11 EUR zuzüglich Zinsen. Die Arbeitgeberin wies die Forderung mit Verweis auf den geschlossenen Vergleich zurück: Durch dessen Abschluss seien alle Ansprüche – einschließlich etwaiger Urlaubsansprüche – erledigt.
Die Entscheidung des BAG
Das BAG gab dem Arbeitnehmer Recht und stellte in seinem Urteil klar, dass die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung, wonach der Urlaub in natura gewährt worden sei, gemäß § 134 BGB insoweit nichtig ist, als sie den nach § 13 Abs. 1 Satz 3 BurlG unabdingbaren Anspruch auf gesetzlichen Mindesturlaub betrifft. Im Einzelnen:
Kein Verzicht auf gesetzlichen Mindesturlaub vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Das BAG hob hervor, dass ein Verzicht auf den gesetzlichen Mindesturlaub oder dessen Abgeltung vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich unzulässig ist. Dies gelte auch dann, wenn – wie im entschiedenen Fall – wegen dauerhafter Arbeitsunfähigkeit feststeht, dass der Urlaub nicht mehr genommen werden konnte. Das Gericht bezog sich unter Verweis auf den Schutzzweck des Urlaubsanspruchs auch auf Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/EG, wonach der Urlaub dem Erholungs- und Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers dient.
Kein Tatsachenvergleich mangels tatsächlicher Unsicherheit
Auch einen Tatsachenvergleich, der trotz § 13 Abs. 1 S. 3 BUrlG möglich wäre, lehnte das BAG ab, da zum Zeitpunkt des Vergleichsschlusses unstreitig feststand, dass der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch des Klägers aufgrund der durchgängigen Erkrankung des Klägers weiterhin bestand. Eine für einen Tatsachenvergleich erforderliche Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Anspruchsvoraussetzungen habe somit nicht vorgelegen.
Kein schutzwürdiges Vertrauen des Arbeitgebers auf offensichtlich rechtswidrige Regelung
Schließlich verwarf das BAG auch den Einwand der Arbeitgeberseite, der Arbeitnehmer habe durch sein Vorgehen gegen Treu und Glauben verstoßen. Der Arbeitnehmer habe sich zwar widersprüchlich verhalten, indem er gleichzeitig dem Prozessvergleich zustimmte und dennoch im Anschluss Klage auf Urlaubsabgeltung erhob. Der Arbeitgeber habe gleichwohl nicht berechtigterweise auf die Wirksamkeit einer Regelung vertrauen dürfen, die offensichtlich gegen zwingendes Recht verstoße.
Auswirkungen auf die Praxis
Das Urteil unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen rechtlichen Prüfung bei der Formulierung von Vergleichsvereinbarungen im arbeitsrechtlichen Kontext sowohl im Hinblick auf Prozessvergleiche als auch bei Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Wirksamkeit eines Verzichts auf den gesetzlichen Mindesturlaub maßgeblich von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängt.
Maßgeblich ist insbesondere der Zeitpunkt des Vergleichsschlusses:
So ist ein Verzicht auf den Abgeltungsanspruch des gesetzlichen Mindesturlaubs bei einer rückwirkenden Beendigung des Arbeitsverhältnisses – also bei einer einvernehmlichen Festlegung eines früheren Beendigungszeitpunkts – zulässig. Hätten sich die Parteien also auf eine Beendigung zum 31. Dezember 2022 geeinigt, stünde dem Arbeitnehmer kein Zahlungsanspruch zu. Die bisherige Praxis kann in dieser Konstellation also beibehalten werden.
Bei Prozessvergleichen, Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen bei denen sich die Parteien auf ein in der Zukunft liegendes Beendigungsdatum verständigen, sollte der jeweilige Rechtsgrund des Urlaubsanspruchs in den Blick genommen werden und soweit möglich zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem (tarif-)vertraglichen Mehrurlaub unterschieden werden. Die Klausel, dass Urlaubsansprüche in natura abgegolten sind, sollte sich dann lediglich auf den verzichtbaren Mehrurlaub beziehen. Der gesetzliche Mindesturlaub sollte nach Möglichkeit im Rahmen einer Freistellungsregelung verrechnet werden. Ist dies – wie in dem vom BAG entschiedenen Fall – beispielsweise aufgrund einer andauernden Erkrankung des Arbeitnehmers oder einer kurzen Kündigungsfrist, die nicht den gesamten Anspruch erfasst, nicht möglich, sollte eine finanzielle Urlaubsabgeltung vereinbart werden. Andernfalls droht auch bei einer vermeintlichen Gesamteinigung eine nachträgliche Inanspruchnahme.
Bei Sachverhalten bei denen Unsicherheit über den Bestand des gesetzlichen Mindesturlaubs besteht, bleibt ein Tatsachenvergleich zudem weiterhin möglich.