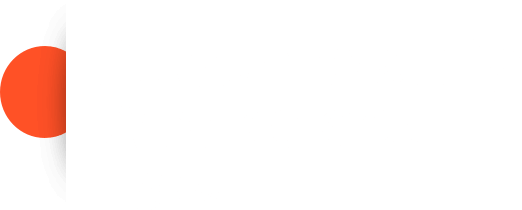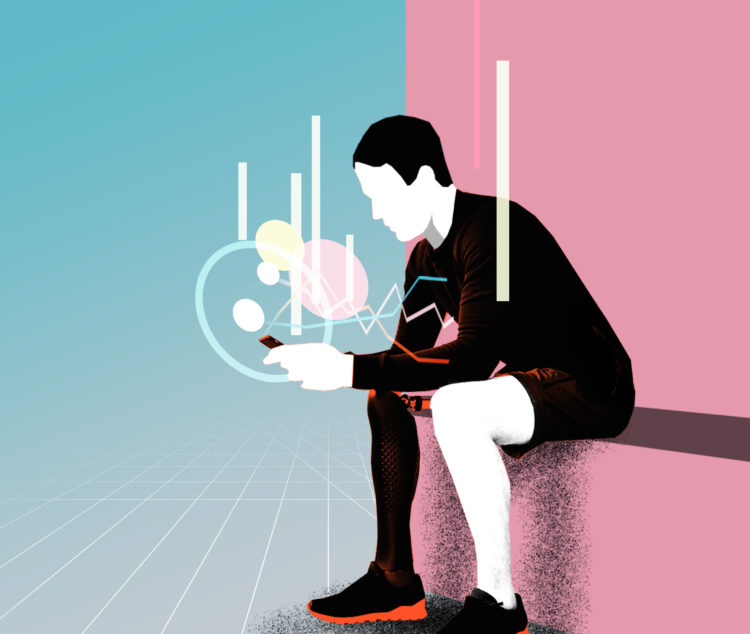Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat entschieden, dass ein schwerbehinderter Arbeitnehmer während der Wartezeit keinen Anspruch auf die Durchführung eines Präventionsverfahrens nach § 167 Abs. 1 SGB IX hat.
Der Kläger, der mit einem Grad der Behinderung von 80 schwerbehindert ist, begann in einem Unternehmen als Leiter der Haus- und Betriebstechnik zu arbeiten. Bereits nach drei Monaten – der Hälfte seiner vertraglich vereinbarten Probezeit und noch innerhalb der Wartezeit gem. § 1 Abs. 1 KSchG – erhielt er eine Kündigung, weil sein Arbeitgeber ihn für fachlich ungeeignet hielt. Gegen diese Kündigung wehrte sich der Kläger und argumentierte, die Kündigung sei unwirksam, weil sein Arbeitgeber vor der Kündigung weder das Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX durchgeführt noch ihm einen behinderungsgerechten Arbeitsplatz angeboten habe; außerdem habe ihn sein Arbeitgeber wegen der bestehenden Schwerbehinderung durch die Kündigung diskriminiert.
Die Klage blieb in allen Instanzen bis hin zum BAG (Urteil vom 03.04.2025 – 2 AZR 178/24) erfolglos.
Das BAG begründet seine überzeugende Entscheidung im Wesentlichen mit drei Argumenten:
1. Zunächst stützt sich das BAG auf den Wortlaut und die Systematik der einschlägigen gesetzlichen Vorschrift (§ 167 Abs. 1 SGB IX) und stellt fest, dass der Wortlaut der Norm die Terminologie des Kündigungsschutzgesetzes aufgreift und das Präventionsverfahren auf ausschließlich personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Schwierigkeiten bezieht, also konkret an die in § 1 Abs. 2 KSchG verwendeten Begriffe „Gründe … in der Person“, „Gründe … in dem Verhalten“ und „dringende betriebliche Erfordernisse“, anknüpft.
Dies zeige bereits, so das BAG, dass das Präventionsverfahren wegen der aufgetretenen Schwierigkeiten nur zu durchlaufen ist, wenn das Kündigungsschutzgesetz anwendbar und ein nach § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG geeigneter Grund einschlägig ist. Hätte der Gesetzgeber unabhängig von der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes die Durchführung des Präventionsverfahrens für erforderlich erachtet, hätte der Gesetzgeber auch generell, zum Beispiel „Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis“ als Voraussetzung benennen können. Es sei kein Grund dafür ersichtlich, sich an die Begrifflichkeiten aus § 1 Abs. 2 KSchG anzulehnen, wenn hierdurch nicht auch ein Bezug zu dieser Vorschrift hergestellt werden soll.
Insofern sei das Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX erst nach Ablauf der Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG, also nach einer sechsmonatigen Betriebszugehörigkeit und nur in Betrieben mit mehr als zehn (Altfälle: fünf) Arbeitnehmern durchzuführen. Während der Wartezeit, die im vorliegenden Fall (ebenso wenig wie die vertraglich vereinbarte Probezeit) noch nicht erfüllt war, besteht diese Pflicht nicht.
Seine Auslegung sieht das Gericht letztlich (und inzwischen) auch durch den Gesetzgeber bestätigt, denn dieser habe – trotz mehrfacher zwischenzeitlicher Änderungen des § 167 Abs. 1 SGB IX – den Wortlaut der Vorschrift nicht korrigiert. Daraus folgert das Bundesarbeitsgericht, dass der Gesetzgeber die Rechtsauffassung des Gerichts – die in der hiesigen Entscheidung fortgesetzt und vertieft wird – akzeptiert hat.
2. Weiterhin führe die Nichtdurchführung eines Präventionsverfahrens auch systematisch nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung. § 167 Abs. 1 SGB IX enthält nämlich – anders als etwa § 178 Abs. 2 S. 3 SGB IX es bei einer fehlenden Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung vorsieht – gerade keine Unwirksamkeitsfolge für den Fall der unterlassenen Durchführung.
3. Und schließlich lag im konkreten Fall auch keine Diskriminierung wegen der Behinderung vor, weil der Arbeitgeber die Kündigung allein mit der mangelnden fachlichen Eignung des Klägers begründet und keine Anhaltspunkte für eine Benachteiligung wegen der Behinderung ins Feld geführt habe. Die Einstellung erfolgte in Kenntnis der Schwerbehinderung.
Da die Kündigung in keinem Zusammenhang mit der Schwerbehinderung des Klägers steht, musste das Gericht auch nicht entscheiden, ob – wie der Kläger meinte – eine Auslegung oder Rechtsfortbildung der Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes dahin möglich ist, dass allein das Unterlassen einer sog. „angemessenen Vorkehrung“ im Sinne der UN Behindertenrechtskonvention (Art. 2 Unterabsatz 4 UN-BRK) bzw. im Sinne der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie (Art. 5 Satz 1, Richtlinie 2000/78/EG) bereits eine Benachteiligung gemäß § 7 Abs. 1, §§ 1, 3 AGG darstellt. Das Präventionsverfahren selbst – so das Bundesarbeitsgericht – ist nämlich keine „angemessene Vorkehrung“ im Sinne dieser Vorschriften, sondern lediglich ein Suchprozess, um solche Vorkehrungen zu ermitteln. Ein Anspruch auf „angemessene Vorkehrungen“ bleibe davon unberührt, gleichwohl könne sich ein Arbeitnehmer gegenüber seinem privatrechtlichen Arbeitgeber nicht unmittelbar auf die Regelungen der UN-BRK oder der Richtlinie 2000/78/EG berufen, um dessen Obliegenheit zum Ergreifen angemessener Vorkehrungen einzufordern, sondern müsse sich mit den nationalrechtlich vorgesehenen Verfahren begnügen, wie hier dem Präventionsverfahren.
Zusammenfassend bestätigt das BAG, dass das Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX während der Wartezeit nach dem KSchG nicht verpflichtend ist und dessen Unterlassen die Wirksamkeit der Wartezeitkündigung nicht berührt. Eine Diskriminierung wegen der Behinderung sei zwar im Einzelfall zu prüfen, lag hier aber nicht vor. Ein direkter Anspruch des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber lässt sich weder aus der UN-Behindertenrechtskonvention noch aus der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie ableiten.