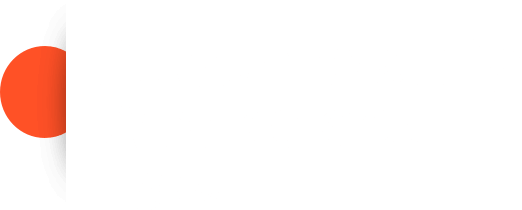Zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat: ein Spannungsfeld
Das deutsche Arbeitsrecht beruht auf einem dualistischen System: Gewerkschaften vertreten die kollektiven Interessen ihrer Mitglieder, während der Betriebsrat die Interessen aller Arbeitnehmer des Betriebs wahrnimmt. In der Praxis verschwimmen diese Linien jedoch immer wieder – etwa, wenn Gewerkschaften im Betrieb aktiv um Mitglieder werben oder Betriebsratsmitglieder zugleich gewerkschaftliche Funktionen übernehmen. Gerade in Wahljahren zeigt sich: Die Neutralität des Betriebsrats gegenüber Gewerkschaften ist nicht bloß eine Formalität, sondern Grundvoraussetzung für eine funktionierende Mitbestimmung.
Was bedeutet Neutralitätspflicht?
Das Betriebsverfassungsgesetz erwähnt die Neutralitätspflicht nicht ausdrücklich, sie ergibt sich aber aus mehreren Vorschriften: § 2 Abs. 1 BetrVG verpflichtet zur vertrauensvollen Zusammenarbeit, § 74 Abs. 2 BetrVG untersagt parteipolitische Betätigung und Arbeitskampfmaßnahmen, und § 75 Abs. 1 BetrVG verpflichtet zur Gleichbehandlung unabhängig von politischer oder gewerkschaftlicher Zugehörigkeit. Aus diesem Zusammenspiel folgt: Der Betriebsrat muss neutral gegenüber allen Beschäftigten agieren – unabhängig davon, ob sie einer Gewerkschaft oder Arbeitnehmerkoalition angehören oder nicht. Nur so kann er seine Rolle als Repräsentant der gesamten Belegschaft glaubwürdig erfüllen.
Koalitionsfreiheit ist kein Freifahrtschein
Art. 9 Abs. 3 GG schützt die positive und negative Koalitionsfreiheit – also das Recht, sich einer Gewerkschaft anzuschließen oder es zu lassen. Auch Betriebsratsmitglieder dürfen selbstverständlich Mitglieder einer Gewerkschaft sein oder bleiben. Aber: Sie dürfen ihr Betriebsratsamt und ihre gewerkschaftliche Tätigkeit nicht vermischen. Wer als Betriebsrat im Namen einer Gewerkschaft auftritt oder Betriebsratsmittel für gewerkschaftliche Zwecke nutzt, verletzt nicht nur die Neutralitätspflicht, sondern auch seine arbeitsvertraglichen Pflichten.
Die Grenzen in der Praxis
Die Trennung ist in der Realität oft schwierig – etwa, wenn Betriebsratsmitglieder in der Belegschaft zugleich als „Gesichter der Gewerkschaft“ wahrgenommen werden. Zulässig bleibt private Gewerkschaftsarbeit in der Freizeit oder außerhalb der Amtsausübung. Unzulässig sind dagegen, die Nutzung jeglicher durch den Arbeitgeber für die Betriebsratsarbeit überlassenen Betriebsmittel, insbesondere betrieblicher Kommunikationsmittel (E-Mail, Intranet, Räume), gewerkschaftliche Werbung oder Betätigung während der Arbeitszeit oder sogar Druck auf Arbeitnehmer, einer bestimmten Gewerkschaft beizutreten.
Neutralität auch im Wahlkampf
Besonders heikel wird es in Wahljahren. Nach § 14 Abs. 3 BetrVG dürfen zwar auch Gewerkschaften Wahlvorschläge einreichen – das ändert aber nichts an der Pflicht amtierender Betriebsräte, im Wahlkampf neutral zu bleiben. Wer Betriebsratsressourcen, Räume oder Arbeitszeit für Wahlwerbung nutzt, verletzt die Neutralitätspflicht. Die Grenze verläuft dort, wo betrieblich finanzierte Mittel (z.B. Kopierer, Intranet, Drucker) für den Wahlkampf eingesetzt werden – das kann sogar strafrechtlich relevant sein (§ 119 BetrVG).
Durchsetzungsmöglichkeiten für Arbeitgeber
Verstößt der Betriebsrat gegen die Neutralitätspflicht, ist die Durchsetzung nicht einfach. Ein unmittelbarer Unterlassungsanspruch aus § 74 BetrVG besteht nicht, weil der Betriebsrat als Organ vermögenslos ist. Allerdings kann der Arbeitgeber nach § 1004 BGB Unterlassung verlangen, wenn seine Betriebsmittel für gewerkschaftliche Zwecke genutzt werden. In schweren Fällen bleibt auch die Möglichkeit, beim Arbeitsgericht den Ausschluss einzelner Betriebsratsmitglieder nach § 23 Abs. 1 BetrVG zu beantragen.
Gilt die Neutralitätspflicht auch für den Arbeitgeber?
Nein. Auch dem Arbeitgeber ist verboten, eine Betriebsratswahl unzulässig mit der Androhung von Nachteilen oder dem Versprechen von Vorteilen zu beeinflussen (§ 20 Abs. 2 BetrVG). Das bedeutet aber nicht, dass der Arbeitgeber einer strengen Neutralitätspflicht unterliegt, vielmehr darf er nach dem Bundesarbeitsgericht (BAG v. 25.10.2017 – 7 ABR 10/16) durchaus im Wahlkampf seine Meinung kundtun, in dem er sich öffentlich kritisch zu bestimmten Listen oder Kandidaten äußert oder Sympathien für Wahlbewerber bekundet. Dem Arbeitgeber ist auch nicht versagt, für die Aufstellung einer alternativen Liste zu werben und die Beschäftigten dazu aufzufordern. Insoweit bleibt es bei der Meinungsfreiheit.
Fazit
Die Neutralitätspflicht ist kein formaler Selbstzweck, sondern Grundlage des Vertrauens in die betriebliche Mitbestimmung. Nur wenn Betriebsräte unabhängig und neutral agieren, können sie die Interessen aller Beschäftigten vertreten – nicht nur die von bestimmten Gruppen. In Zeiten wachsender gewerkschaftlicher Vielfalt und zunehmend polarisierter Wahlkämpfe ist die Notwendigkeit dieser Trennung aktueller denn je. Und es bleibt nicht zu vergessen: Spätestens nach der Wahl ist man als Betriebsratsmitglied wieder Betriebsrat für alle Beschäftigten und nicht nur von den Beschäftigten, die der unterstützen Gewerkschaft angehören.
Was heißt das für die Praxis?
• Klare Trennung: Betriebsratsmitglieder sollten private und betriebsverfassungsrechtliche Tätigkeiten strikt voneinander trennen. Auch dürfen gewerkschaftliche Aktivitäten nicht in der Arbeitszeit stattfinden. Wird dies nicht beachtet, liegt möglicherweise ein Arbeitszeitbetrug vor, der den Arbeitgeber zur Kündigung berechtigen kann.
• Ressourcenschutz: Betriebsmittel dürfen ausschließlich für Betriebsratsarbeit und nicht zu anderen Zwecken genutzt werden. Die unberechtigte Nutzung der Betriebsmittel des Arbeitgebers kann eine Unterschlagung darstellen und ebenfalls arbeitsrechtliche Konsequenzen auslösen.
• Überwachung: Die Einhaltung der Neutralitätspflicht hat auch die Arbeitgeberseite zu überwachen, da bei Nichteinschreiten der Vorwurf der Untreue auch für Personalverantwortliche im Raum stehen kann. Die Betriebsmittel des Arbeitsgebers dienen der Förderung seines Betriebszwecks und nicht der kostenfreien Nutzung durch Dritte.
•Schulungen: HR und Betriebsrat sollten mindestens vor jeder Wahl über Neutralitätspflichten sprechen und hier ein gemeinsames Verständnis herstellen. In der Praxis hierzu bestehende Missverständnisse können nur so ausgeräumt werden.
Näheres zur Neutralitätspflicht: Schönhöft/Weyhing, Neutralitätspflicht und Koalitionsfreiheit des Betriebsrats, BB 2014, S.762.