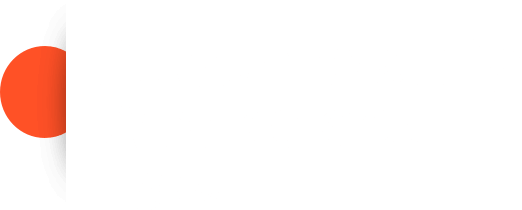Ein Bewerbungsfoto, eine Absage – und eine Begründung, die sich erst auf den zweiten Blick erschließt
Eine muslimische Bewerberin für die Stelle einer Luftsicherheitsassistentin am Hamburger Flughafen erhält eine Absage – offiziell wegen einer Lücke im Lebenslauf, tatsächlich aber, so die Vermutung der Gerichte, wegen ihres Kopftuchs.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 29. Januar 2026 (8 AZR 49/25) klargestellt: Ein pauschales Kopftuchverbot für Luftsicherheitsassistentinnen ist nicht gerechtfertigt – auch nicht im sicherheitssensiblen Bereich eines Flughafens und auch nicht unter Berufung auf ein vermeintliches staatliches Neutralitätsgebot.
Damit korrigiert das BAG eine weit verbreitete Fehlannahme über Neutralität, Sicherheit und die Grenzen der Religionsfreiheit und stärkt die Rechte von Bewerberinnen und Beschäftigten erheblich.
Zum Zeitpunkt dieses Beitrags liegt bislang lediglich die Pressemitteilung des BAG vor; die schriftlichen Urteilsgründe stehen noch aus. Gleichwohl lassen sich die tragenden Argumentationslinien bereits der Pressemitteilung entnehmen – und sie geben eine klare Richtung für die weitere rechtliche und betriebliche Praxis vor.
Das BAG-Urteil in Kürze
Mit Urteil vom 29. Januar 2026 (8 AZR 49/25) stellt das BAG klar:
- Eine Tätigkeit als Luftsicherheitsassistentin an der Passagier- und Gepäckkontrolle darf grundsätzlich mit religiösem Kopftuch ausgeübt werden.
- Ein pauschaler Verweis auf ein staatliches Neutralitätsgebot rechtfertigt kein Kopftuchverbot.
- Der Klägerin ist eine Entschädigung zu zahlen (§ 15 Abs. 2 AGG).
Was war genau geschehen?
Die Geschichte beginnt 2023 am Hamburger Flughafen. Die Klägerin ist muslimischen Glaubens und trägt aus religiösen Gründen stets ein Kopftuch. Sie bewarb sich bei einem Sicherheitsunternehmen auf die Stelle einer Luftsicherheitsassistentin für Passagier- und Gepäckkontrollen. Das Unternehmen führt im Auftrag der Bundesrepublik Sicherheitskontrollen durch, ist aber privatrechtlich organisiert (GmbH).
Im Bewerbungsverfahren reichte sie einen Lebenslauf mit Passfoto ein. Das Foto zeigte sie mit einem roten Kopftuch, das die Haare vollständig bedeckt, das Gesicht aber offen lässt. Kurz darauf kam die Absage – zunächst ohne Begründung. Auf telefonische Nachfrage hieß es vage: Es gebe eine Lücke im Lebenslauf, man werde nachfragen und sich melden. Eine Rückmeldung blieb aus.
Die Klägerin war überzeugt, dass die Absage aufgrund ihres Kopftuchs und nicht aufgrund ihres Lebenslaufs erfolgte. Sie klagte und forderte eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG wegen Benachteiligung aufgrund der Religion (§ 7 Abs. 1 AGG i. V. m. Art. 4 GG).
Worum geht es rechtlich?
Nach § 7 Abs. 1 AGG dürfen Beschäftigte bzw. Bewerberinnen und Bewerber nicht wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes benachteiligt werden, also insbesondere nicht wegen ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes in einem Bewerbungsprozess nicht berücksichtigt oder abgelehnt, ist das die Stelle ausschreibende Unternehmen verpflichtet, ihr oder ihm den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen und eine angemessene Entschädigung in Geld zu zahlen (vgl. § 15 AGG).
Grundsätzlich trägt die Person, die einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG geltend macht, die Darlegungslast für das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen. § 22 AGG sieht jedoch eine Beweiserleichterung vor: Gelingt es der benachteiligten Person, Indizien vorzutragen, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten lassen, kehrt sich die Beweislast um. Dann muss das Unternehmen nachweisen, dass keine Benachteiligung stattgefunden hat.
Genau das ist in diesem Fall passiert: Das Arbeitsgericht Hamburg, das Landesarbeitsgericht Hamburg und schließlich das BAG sahen die seitens der Klägerin vorgetragenen Indizien als ausreichend an, um eine Diskriminierung wegen der Religion wahrscheinlich zu machen – der „Ball” lag beim Unternehmen, das die Vermutung nicht entkräften konnte.
Entscheidend war dabei insbesondere:
- Das Bewerbungsfoto zeigte die Klägerin mit Kopftuch. Für erfahrene Personalverantwortliche im Sicherheitsbereich war damit erkennbar, dass sie dieses auch während der Tätigkeit tragen würde.
- Die Beklagte ging selbst davon aus, dass die Tätigkeit als Luftsicherheitsassistentin ohne Kopftuch auszuüben sei. Sie berief sich auf ein von der Bundespolizei verlangtes „Neutralitätsgebot“ und bestätigte im Verfahren, dass Mitarbeiterinnen mit Kopftuch dieses während der Arbeitszeit abzulegen hätten. Zudem verwies sie auf eine Konzernbetriebsvereinbarung, die Kopfbedeckungen grundsätzlich untersagt, sofern sie nicht Teil der Dienstkleidung oder aus Gründen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.
In der Gesamtwürdigung genügten diese Umstände den Gerichten, um eine Benachteiligung wegen der Religion zu vermuten. Der pauschale Verweis auf Lücken im Lebenslauf blieb demgegenüber formelhaft. Ein konkreter, nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen diesen Lücken und der Ablehnung wurde nicht aufgezeigt.
Neutralitätsgebot – aber nur mit gesetzlicher Grundlage oder konkreter Gefahr
Besonders aufschlussreich sind die gerichtlichen Ausführungen dort, wo es um eine mögliche Rechtfertigung der Benachteiligung wegen der Religion geht. Im Zentrum stand dabei das von der beklagten Sicherheitsfirma geltend gemachte „Neutralitätsgebot“.
Die Beklagte argumentierte, sie sei als beliehenes Unternehmen im Bereich der Flugsicherheitskontrolle faktisch „verlängerter Arm“ der Bundespolizei. Für ihre Beschäftigten gelte daher ein staatliches Neutralitätsgebot, das das Tragen sichtbarer religiöser Symbole ausschließe.
Die Gerichte folgten dieser Argumentation allerdings nicht:
1. Keine Rechtfertigung nach § 8 Abs. 1 AGG
Nach § 8 Abs. 1 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung nur ausnahmsweise zulässig, wenn der betreffende Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt. Diese Ausnahme ist eng auszulegen.
Diese hohe Hürde ist hier nicht erreicht. Die Kernaufgaben einer Luftsicherheitsassistentin – Gepäckkontrollen, Dokumentenprüfung und Kommunikation mit Passagieren – können mit Kopftuch ebenso ordnungsgemäß ausgeübt werden wie ohne. Weder technisch noch rechtlich ist das Tragen religiöser Kopfbedeckungen zwingend ausgeschlossen. Das Nichttragen eines Kopftuchs ist daher keine zulässige Zugangsvoraussetzung für diese Tätigkeit.
2. Beliehene Unternehmen unterliegen nicht automatisch einem allgemeinen Neutralitätsgebot
Zwar können für Beamte und bestimmte hoheitliche Funktionen besondere Neutralitätsanforderungen gelten; daraus folgt aber kein Automatismus: Weder jede hoheitliche Aufgabe noch jede Nähe zum Staat rechtfertigt ein generelles Verbot religiöser Bekleidung. Entscheidend ist vielmehr, ob eine tragfähige gesetzliche Grundlage besteht.
Daran fehlte es im Streitfall. Eine Rechtsverordnung, die ein Kopftuchverbot für die von der Beklagten eingesetzten Sicherheitskräfte verbindlich angeordnet hätte, existiert nicht.
3. Abstrakte Befürchtungen genügen nicht
Die Beklagte hatte zudem geltend gemacht, an den Sicherheitskontrollen herrsche häufig eine angespannte und konfliktreiche Stimmung. Sichtbare religiöse Symbole könnten diese Situation weiter verschärfen und zu Konflikten mit Passagieren führen.
Auch diesem Argument erteilt das BAG eine klare Absage. Solche Erwägungen bleiben abstrakt und spekulativ. Es fehlte an konkreten, belegten Anhaltspunkten dafür, dass das Tragen eines Kopftuchs bei Flugsicherheitskontrollen regelmäßig zu Konflikten oder Sicherheitsproblemen führt.
Damit knüpft das BAG an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an: Eingriffe in die durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützte Religionsfreiheit sind nur bei Vorliegen einer hinreichend konkreten Gefahr für ein schutzwürdiges Rechtsgut gerechtfertigt. Bloße abstrakte Risiken oder pauschale Befürchtungen reichen nicht aus. Ein pauschales Kopftuchverbot ist daher unverhältnismäßig.
Was sind die Folgen des Urteils?
Das Urteil zeigt einen klaren Trend in der deutschen Rechtsprechung: Religion und Religionsfreiheit (Art. 4 GG) werden ernst genommen. Es fügt sich in eine Linie der BAG-Rechtsprechung ein und hat zugleich eine deutliche Klarstellungsfunktion:
- Pauschale Neutralitätsverpflichtungen ohne konkrete Gefahrenlagen sind nicht tragfähig – auch nicht im Sicherheitsbereich.
- Der bloße Wunsch des Arbeitgebers nach einem „weltanschaulich neutralen“ äußeren Erscheinungsbild seiner Belegschaft ist nicht mit Art. 4 GG und der EMRK vereinbar.
Für die Praxis bedeutet das:
- Pauschale Kopftuchverbote sind diskriminierungsrechtlich problematisch. Arbeitgeber, die in Betriebsvereinbarungen oder internen Policies ein allgemeines Verbot von Kopfbedeckungen oder religiösen Symbolen vorsehen, geraten schnell in den Verdacht einer mittelbaren oder unmittelbaren Benachteiligung nach § 7 AGG.
- „Neutralität“ rechtfertigt keine flächendeckenden Verbote. Es bedarf objektiver, belegbarer Gründe, warum gerade in der konkreten Tätigkeit und Situation religiöse Symbole unzulässig sein sollen.
- Indizien genügen – die Beweislast liegt beim Arbeitgeber. Schon ein Bewerbungsfoto mit Kopftuch, eine anschließende unbegründete Absage und interne Regelungen, die das Tragen von Kopftüchern faktisch ausschließen, können die Indizwirkung nach § 22 AGG auslösen. Ihre Widerlegung erfordert mehr als pauschale Hinweise auf Lebenslauf-Lücken.
- Entschädigungsrisiken sind real. Entschädigungen in Höhe eines Bruttomonatsgehalts bewegen sich im üblichen Rahmen für Diskriminierungsfälle dieser Art, können in der Summe (und in Wiederholungsfällen) aber spürbare finanzielle und reputative Folgen haben.